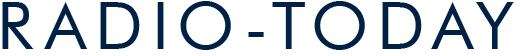Radioprogramm
Deutschlandfunk
- 104.6 RTL Berlin
- 88vier
- 89,0 RTL
- 93,6 JAM FM BERLIN
- 94,3 rs2
- Alex Berlin
- Antenne 1
- Antenne Bayern
- Antenne Brandenburg
- Antenne Düsseldorf
- Antenne Niedersachsen
- Antenne Thüringen
- Apollo Radio
- Bayern 1
- Bayern 2
- Bayern 3
- BB RADIO
- Berliner Rundfunk
- Bermuda.funk
- bigFM
- BR puls
- BR Schlager
- BR-Heimat
- BR-Klassik
- BR24
- Bremen 4
- Bremen Eins
- Bremen Zwei
- byteFM
- Charivari 95,5
- Cosmo
- DasDing
- Delta radio
- Deluxe Lounge Radio
- Deluxe Music Radio
- Deutschlandfunk
- Deutschlandfunk Kultur
- Deutschlandfunk Nova
- Die Maus
- Die Neue Welle
- egoFM
- Eins Live
- Energy Berlin
- Energy Bremen
- ERF Plus
- FluxFM Berlin
- Fritz
- GrooveFM
- HardBase.FM
- harmony.fm
- Hit Radio FFH
- Hitradio RTL
- hr iNFO
- HR1
- HR2
- HR3
- HR4
- JazzRadio
- KISS FM
- Klassik Radio
- LandesWelle Thüringen
- Life Radio
- Literatur-Musik
- LoungeFM
- Mallorca Inselradio
- MDR AKTUELL
- MDR JUMP
- MDR KLASSIK
- MDR KULTUR
- MDR SACHSEN Dresden
- MDR SACHSEN-ANHALT Magdeburg
- MDR SPUTNIK OnAir Channel
- MDR THÜRINGEN Erfurt
- MDR TWEENS
- Memoryhits FM<>Heartbeatradio
- N-Joy Radio
- NDR 1 Niedersachsen
- NDR 1 Radio MV
- NDR 1 Welle Nord
- NDR 2
- NDR 90,3
- NDR Blue
- NDR Info
- NDR Info Spezial
- NDR kultur
- NDR Schlager
- Ostseewelle
- Planet radio
- PopStop - das Musikradio
- R.SA
- R.SH
- Radio 21
- Radio 24
- Radio 7
- Radio 700
- Radio Blau
- Radio BOB!
- Radio Bollerwagen
- Radio Brocken
- Radio CORAX
- Radio Erft
- Radio ffn
- RADIO fresh80s
- Radio Ganymed
- Radio GoldStar
- Radio Gong
- Radio Hamburg
- radio hbw
- Radio Horeb
- Radio Jodlerwirt
- Radio Lausitz
- Radio LORA
- Radio Matchbox
- Radio Nachteule
- Radio Neandertal
- Radio Paloma
- Radio Paradiso
- Radio PSR
- Radio Regenbogen
- Radio Roland
- Radio RPR Eins
- Radio Salü
- Radio SAW
- Radio Siegen
- Radio Swiss Jazz
- Radio TEDDY
- Radio Zett
- Radio2-Day
- radio3
- RadioAktiv
- RadioBerlin 88acht
- RadioEINS
- rbb24 Inforadio
- Rock Antenne
- Rock Antenne Hamburg
- Rockland Radio
- rumir
- Schlager Radio
- Schwarzwaldradio
- Spreeradio 105,5
- SR1 Europawelle Saar
- SR2 Kulturradio
- SR3 Saarlandwelle
- SRF 1
- SRF 2 Kultur
- SRF 3
- SRF 4 News
- SRF Musikwelle
- SRF Virus
- Star FM
- Sublime FM
- Sunshine Live
- SWR Aktuell
- SWR Kultur
- SWR1 Baden- Württemberg
- SWR1 Rheinland-Pfalz
- SWR3
- SWR4 Baden-Württemberg
- SWR4 Rheinland-Pfalz
- TechnoBase.FM
- thejazzofwiesbaden
- TIDE 96.0
- Toggo Radio Live
- top100station
- Top20radio
- TSF
- u-Kultradio
- UnserDing
- WDR2
- WDR3
- WDR4
- WDR5
- YOU FM
Geistliche Musik
Dietrich Buxtehude "Singet dem Herrn ein neues Lied". Kantate für Sopran, Violine und Basso continuo, BuxWV 98 Barbara Christina Steude, Sopran Lautten Compagney Leitung: Wolfgang Katschner Jan Dismas Zelenka "Lobet den mächtigen Gott". Motette für Bass und Orchester, Ps 150 , ZWV 165 (Chvalte Boha silného) Tomás Král, Bass Musica Florea Leitung: Marek Stryncl Flemmik "Sanctus" Cappella Mariana Leitung: Vojtech Semerád Johann Caspar Kerll Ricercata Wolfgang Kogert, Orgel Johann Sebastian Bach "Wo gehest du hin?". Kantate zum Sonntag Cantate, BWV 166 Guro Hjemli, Sopran Terry Wey, Alt Gerd Türk, Tenor Markus Volpert, Bass Chor der J. S. Bach-Stiftung St. Gallen Orchester der J. S. Bach-Stiftung St. Gallen Leitung: Rudolf Lutz
Am Sonntagmorgen
Religiöses Wort "Seigneur, mon Ami." Zum 40. Todestag von Aimé Duval Von Christian Feldmann Katholische Kirche
Essay und Diskurs
Von der Kunst zu heilen - Auf der Suche nach wirklicher Gesundheit Aus dem Englischen von Beatrice Faßbender Von Priya Basil Gesundheit ist ein wertvolles Gut. Gleich verteilt ist es im Blick auf die weltweite medizinische Versorgung nicht. Rund 80 Prozent der Menschen sind, so die Weltgesundheitsorganisation, auf traditionelle Medizin angewiesen. Damit spielt sie eine zentrale Rolle. In einer Studie der Weltbank in Kenia aus dem Jahr 2011 wurde geschätzt, dass auf 950 Menschen ein Heiler kommt, verglichen mit einem Arzt auf 33.000. In Deutschland kamen im Jahr 2020 auf 1.000 Einwohner 4,5 Ärzte. Die bloße Zugänglichkeit macht traditionelle Heiler zu einer praktikableren Option. Obwohl die Mehrheit der Afrikaner traditionelle Medizin konsumiert, ist sie in vielen afrikanischen Ländern immer noch illegal. Was wäre, wenn wir beginnen würden, von "elementarer Gesundheit" zu sprechen? Und damit die psychische Gesundheit ebenso berücksichtigen wie die Rolle von Beziehungen und der Gemeinschaft als Grundlage für das individuelle Wohlbefinden? Könnten solche Begriffe dazu führen, die moderne medizinische Vorstellungskraft zu erweitern und den Rahmen dafür zu verschieben, was die wirksamste Medizin ausmacht? Die Bewertung der traditionellen Medizin führt jedenfalls tief hinein in die Fragen, welche Kriterien man an Gesundheit, etwa auch mentale Gesundheit anlegt, wie traditionelles Wissen bewahrt und weitergegeben werden kann in einer Welt, die von der leistungsstarken westlichen Medizin dominiert wird. Und sie führt uns zurück auf Fragen des Kolonialismus zum Beispiel in Afrika, denn oft war, was traditionelle Heilkunst ausmacht, für die Kolonisatoren nichts anderes als Hexerei. Priya Basil, geboren 1977, ist - so schrieb das Magazin "Wired" - "eine britische, kenianische, indische, in Deutschland lebende Schriftstellerin, deren Leben nicht zwischen zwei Buchdeckel passt, da es einfach zu unglaublich ist." Sie ist unter anderem eine Initiatorin des Aufrufs "Die Demokratie verteidigen im Digitalen Zeitalter" und Mitbegründerin des Aktionsbündnisses "Wir machen das. Für eine postmigrantische Gesellschaft". Zwischen zwei Buchdeckel passt u.a. ihr Roman "Die Logik des Herzens" (2012), ihr Buch "Gastfreundschaft" (2019) oder "Im Wir und Jetzt - Feministin werden" (2019).
Gottesdienst
Übertragung aus dem House of One in Berlin Predigt: Pfarrer Gregor Hohberg, Rabbiner Andreas Nachama, Imam Kadir Sanci
Zwischentöne
Musik und Fragen zur Person Die Dokumentarfilmerin Regina Schilling im Gespräch mit Marietta Schwarz Ihr Film "Kulenkampffs Schuhe" wurde mit Preisen überhäuft. Darüber hinaus begleitete Regina Schilling den Pianisten Igor Levit mit der Kamera und machte eine Doku über "Aktenzeichen XY... ungelöst". Sie ist Kinderbuchautorin und arbeitete für die lit.COLOGNE.
Rock et cetera
Familientreffen der großen Unbekannten Die US-amerikanische Band The Immediate Family Von Fabian Elsäßer Die 70er- und 80er-Jahre waren die große Zeit der Sessionmusiker, und manche von ihnen wurden zu heimlichen Stars: beliebt bei den Arbeitgebern, bei Musikhörern eher unbekannt. Außer, man macht sich die Mühe, das Kleingedruckte auf Albumhüllen zu lesen. Bei Werken von US-Künstlern wie Jackson Browne, James Taylor oder Linda Ronstadt findet man dann regelmäßig die Namen von Schlagzeuger Russ Kunkel, Gitarrist Danny Kortchmar und Bassist Leland Sklar - oft auch alle auf einmal, denn sie bildeten zusammen die Studio-Band The Section. Auch Gitarrist Waddy Wachtel ist eine feste Größe im Hintergrund, als Begleitmusiker von Stevie Nicks etwa. Die vier alten Freunde, inzwischen alle Ende 70, haben mit The Immediate Family eine Band gegründet, mit der sie eigenes Material verwirklichen - und dabei ihre Erfahrung von etwa 5.000 Studio-Aufnahmen mitgebracht.
Forschung aktuell - KI verstehen
KI verstehen - Der Podcast über Künstliche Intelligenz im Alltag Künstliche Intelligenz revolutioniert unseren Alltag. Sie übersetzt Texte, filtert Nachrichten, analysiert Röntgenbilder und entscheidet, wer einen Job bekommt. In "KI verstehen" geben wir jede Woche Antworten auf Fragen zum Umgang mit KI.
Freistil
Indien und die Beatles Auf den Spuren einer anhaltenden Faszination Von Sigrid Pfeffer Regie: Axel Pleuser Produktion: WDR 2023 Im Februar 1968 reisten die Beatles nach Rishikesh in Indien, um im Ashram des Gurus Maharishi Mahesh Yogi zu meditieren. Es war ein medienwirksames Aufeinandertreffen von westlicher und östlicher Kultur. Doch wer hat eigentlich wen inspiriert? Blumenbekränzte Beatles am Ufer des Ganges - die Fernsehbilder gingen rund um den Globus. Musikalisch war es beileibe nicht der erste Kontakt zwischen den Welten: Jazz und Beat waren längst in Indien angekommen. Tatsächlich aber bedeutete der Besuch in Rishikesh eine tiefe Zäsur. Der Westen begann, sich für die klassische indische Musik zu interessieren. Und für indische Musiker veränderte sich durch die Beatles der Blick auf Musik überhaupt. Das Musikportrait begibt sich auf Spurensuche in Delhi, Rishikesh, Mumbai und Goa. Zeitzeugen, Musikerinnen und Musiker aus der vielfältigen indischen Musikszene von damals und heute erzählen, wie sie persönlich von den Beatles und westlicher Musik beeinflusst wurden.
Konzertdokument der Woche
Mozartfest Würzburg 2023 Lisa Streich "Händeküssen" für Barockorchester Wolfgang Amadeus Mozart Menuett Nr.1 A-Dur, KV 601 Anton Kraft Konzert für Violoncello und Orchester C-Dur, op. 4 Johannes Brahms Serenade Nr. 1 D-Dur, op. 11 Jean-Guihen Queyras, Violoncello Ensemble Resonanz Leitung: Riccardo Minasi Aufnahme vom 18.6.2023 aus dem Kaisersaal der Würzburger Residenz Am Mikrofon: Sylvia Systermans "Eine verrückte Gruppe voller Idealisten" nennt Riccardo Minasi das Ensemble Resonanz. Das Kammerorchester und sein ständiger Gastdirigent sind ein ideales Gespann. Mitreißend und überraschend interpretieren sie Werke auf modernen Instrumenten historisch informiert. Auch beim Mozartfest Würzburg. Im Stück "Händeküssen" von Lisa Streich geht es um die Frage wie ein Mensch, der die Musik nicht hören kann, einen Tanz erlebt. Die Komponistin findet dafür schemenhafte, rhythmische Geräusche und Klänge, als säße man im Ohr eines gehörlosen Tänzers. Mozart hat das Tanzen so geliebt wie Billardspielen. Seine Menuette schrieb er für die Bälle der Wiener Gesellschaft. Inspiriert von seinem Freund Mozart schrieb Anton Kraft sein hochvirtuoses Cellokonzert op.4. Ausladend wie eine Sinfonie und heiter wie eine Serenade von Mozart spielte das Ensemble Resonanz die Serenade Nr.1 von Johannes Brahms.