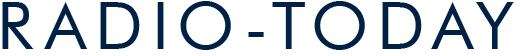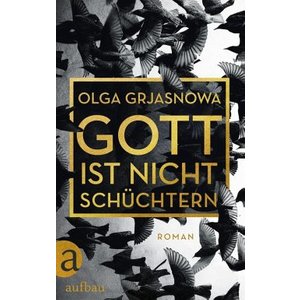Radioprogramm
Deutschlandfunk Kultur
- 104.6 RTL Berlin
- 88vier
- 89,0 RTL
- 93,6 JAM FM BERLIN
- 94,3 rs2
- Alex Berlin
- Antenne 1
- Antenne Bayern
- Antenne Brandenburg
- Antenne Düsseldorf
- Antenne Niedersachsen
- Antenne Thüringen
- Apollo Radio
- Bayern 1
- Bayern 2
- Bayern 3
- BB RADIO
- Berliner Rundfunk
- Bermuda.funk
- bigFM
- BR puls
- BR Schlager
- BR-Heimat
- BR-Klassik
- BR24
- Bremen 4
- Bremen Eins
- Bremen Zwei
- byteFM
- Charivari 95,5
- Cosmo
- DasDing
- Delta radio
- Deluxe Lounge Radio
- Deluxe Music Radio
- Deutschlandfunk
- Deutschlandfunk Kultur
- Deutschlandfunk Nova
- Die Maus
- Die Neue Welle
- egoFM
- Eins Live
- Energy Berlin
- Energy Bremen
- ERF Plus
- FluxFM Berlin
- Fritz
- GrooveFM
- HardBase.FM
- harmony.fm
- Hit Radio FFH
- Hitradio RTL
- hr iNFO
- HR1
- HR2
- HR3
- HR4
- JazzRadio
- KISS FM
- Klassik Radio
- LandesWelle Thüringen
- Life Radio
- Literatur-Musik
- LoungeFM
- Mallorca Inselradio
- MDR AKTUELL
- MDR JUMP
- MDR KLASSIK
- MDR KULTUR
- MDR SACHSEN Dresden
- MDR SACHSEN-ANHALT Magdeburg
- MDR SPUTNIK OnAir Channel
- MDR THÜRINGEN Erfurt
- MDR TWEENS
- Memoryhits FM<>Heartbeatradio
- N-Joy Radio
- NDR 1 Niedersachsen
- NDR 1 Radio MV
- NDR 1 Welle Nord
- NDR 2
- NDR 90,3
- NDR Blue
- NDR Info
- NDR Info Spezial
- NDR kultur
- NDR Schlager
- Ostseewelle
- Planet radio
- PopStop - das Musikradio
- R.SA
- R.SH
- Radio 21
- Radio 24
- Radio 7
- Radio 700
- Radio Blau
- Radio BOB!
- Radio Bollerwagen
- Radio Brocken
- Radio CORAX
- Radio Erft
- Radio ffn
- RADIO fresh80s
- Radio Ganymed
- Radio GoldStar
- Radio Gong
- Radio Hamburg
- radio hbw
- Radio Horeb
- Radio Jodlerwirt
- Radio Lausitz
- Radio LORA
- Radio Matchbox
- Radio Nachteule
- Radio Neandertal
- Radio Paloma
- Radio Paradiso
- Radio PSR
- Radio Regenbogen
- Radio Roland
- Radio RPR Eins
- Radio Salü
- Radio SAW
- Radio Siegen
- Radio Swiss Jazz
- Radio TEDDY
- Radio Zett
- Radio2-Day
- radio3
- RadioAktiv
- RadioBerlin 88acht
- RadioEINS
- rbb24 Inforadio
- Rock Antenne
- Rock Antenne Hamburg
- Rockland Radio
- rumir
- Schlager Radio
- Schwarzwaldradio
- Spreeradio 105,5
- SR1 Europawelle Saar
- SR2 Kulturradio
- SR3 Saarlandwelle
- SRF 1
- SRF 2 Kultur
- SRF 3
- SRF 4 News
- SRF Musikwelle
- SRF Virus
- Star FM
- Sublime FM
- Sunshine Live
- SWR Aktuell
- SWR Kultur
- SWR1 Baden- Württemberg
- SWR1 Rheinland-Pfalz
- SWR3
- SWR4 Baden-Württemberg
- SWR4 Rheinland-Pfalz
- TechnoBase.FM
- thejazzofwiesbaden
- TIDE 96.0
- Toggo Radio Live
- top100station
- Top20radio
- TSF
- u-Kultradio
- UnserDing
- WDR2
- WDR3
- WDR4
- WDR5
- YOU FM
Weltzeit
Moderation: Katrin Materna 50 Jahre Nelkenrevolution Portugals Diktatur wirkt bis heute Von Christina Weise Es waren revolutionäre Militärs, die am 25. April 1974 António de Oliveira Salazar stürzten. Die Diktatur in Portugal war damit nach gut vier Jahrzehnten beendet. Nelken in den Gewehrläufen der Putschisten wurden zum Symbol des Umbruchs. Der Weg für eine demokratische Entwicklung des Landes war geebnet, für ein Leben in Freiheit. Doch es gab viel aufzuholen. Wie prägt das die Gesellschaft in Portugal heute? Und wie steht's mit der Aufarbeitung der Diktatur? Lange galt Portugal als immun gegen rechts. Ausgerechnet kurz vor dem 50. Jahrestag der Nelkenrevolution haben Rechtspopulisten bei der Parlamentswahl im März kräftig zugelegt.
Zeitfragen. Feature
Vor 50 Jahren Nelkenrevolution in Portugal: Ein Militärputsch beendet die jahrzehntelange Diktatur Von Hans Rubinich Die rote Nelke - das Symbol der sozialistischen Arbeiterbewegung - gab der Revolution 1974 ihren Namen. Wie aktuell sind ihre Ideale heute noch? In der Nacht zum 25. April 1974 sendete der katholische Radiosender Rádio Renascença ein besonderes Lied. Es hieß "Grândola Vila Morena" und war ein antifaschistisches Kampflied. Es war das verabredete Zeichen für den Umsturz. In dieser Nacht stürzte das Militär die Diktatur des Estado Novo. Es widersetzte sich der Regierung und forderte ein Ende des Kolonialkriegs Portugals. Der Putsch verlief fast unblutig. Die Soldaten steckten roten Nelken an die Uniformen und in ihre Gewehrläufe. Die rote Nelke war ein Symbol der sozialistischen Arbeiterbewegung, ihre Ideen prägten die Revolution. Nur: In einer Zeit, in der rechte Kräfte europaweit wieder salonfähig werden, inwieweit sind da die Ideen von damals noch aktuell?
Konzert
Wigmore Hall, London Aufzeichnung vom 05.02.2024 Camille Saint-Saëns Sonate für Oboe und Klavier D-Dur op. 166 Henri Dutilleux Sonate für Oboe und Klavier Tsotne Zedginidze Sonate für Oboe und Klavier (Uraufführung) Eugène Bozza "Fantaisie pastorale" op. 37 Claude Debussy/Gilles Silvestrini Rhapsodie für Saxofon und Orchester, arrangiert für Englischhorn und Klavier François Leleux, Oboe, Englischhorn Emmanuel Strosser, Klavier Wigmore Hall, London Aufzeichnung vom 04.03.2024 Lieder von Nadia und Lili Boulanger Lucile Richardot, Mezzosopran Anne de Fornel, Klavier Der französische Star-Oboist François Leleux präsentiert in seinem Lunch-Konzert unbekannte Schätze des Repertoires. Mit dabei auch ein neues Stück eines 15 Jahre alten georgischen Wunderkindes. In einem weiteren Wigmore-Programm singt Lucile Richardot Lieder der genialen Boulanger-Schwestern.
Alte Musik
Andreas Oswald Sonaten Capella Jenensis Eine neue Produktion der Capella Jenensis: farbenprächtige Meisterwerke eines unbekannten Komponisten aus dem 17. Jahrhundert Sein kurzes Leben war von Schicksalsschlägen überschattet, das knappe Gehalt als Stadtorganist in Eisenach reichte kaum aus, um die Familie zu ernähren. Aber Andreas Oswalds schmales überliefertes ?uvre eröffnet eine faszinierende Klangwelt. Es sind 18 Sonaten für kleine Instrumentalensembles, experimentell in der Form, kühn in der Harmonik, ungeheuer farbenreich in der Instrumentierung. Die Capella Jenensis hat in einer Koproduktion mit Deutschlandfunk Kultur zwölf der Sonaten aufgenommen, einige davon in Ersteinspielungen. In der Sendung gibt Carl-Philipp Kaptain, Posaunist des Ensembles und Herausgeber der ersten Notenedition der Sonaten, Einblicke in die Hintergründe der Aufnahme und in die musikalische Welt Andreas Oswalds.
Hörspiel
Gott ist nicht schüchtern (2/2) Nach dem gleichnamigen Roman von Olga Grjasnowa Regie: Sophie Garke Mit: Kristin Alia Hunold, Sabrina Amali, Mohamed Achour, Elias Reichert, Camill Jammal, Patrick Mölleken, Aurelie Thepaut, Valentina Celahmetovic, Gareth Charles, Nils Kretschmer, Kais Setti, Michael Stange, Jasmin Hahn, Maya Bothe, Sophie Garke, Anas Ouriaghli, Dominik Freiberger Ton und Technik: Jürgen Glosemeyer und Barbara Göbel Produktion: WDR 2021 Länge: 52'59 Der Krieg in Syrien stellt junge Menschen vor schwierige Entscheidungen: Sollen sie das Land verlassen? Amal und Hammoudi finden sich auf einem Schlauchboot wieder, das hoffentlich, so Gott will, in die richtige Richtung treiben wird. Syrien ist der gefährlichste Ort der Welt geworden. Es heißt: töten oder getötet werden. Im zweiten Teil des Dramas von Olga Grjasnowa reist Amal nach Beirut. Sie plant ihre Flucht nach Europa und versucht, das Geld für die Schlepper zusammenzukratzen. Hammoudi ist als Arzt im Krieg damit beschäftigt, so viele Leben zu retten wie möglich - bis auch ihm keine andere Wahl bleibt als die Flucht über die Türkei und schließlich das Meer nach Europa. Für beide ist ein winziges Schlauchboot die letzte Rettung. Auf dem Ozean treibend hoffen sie, lebend auf Lesbos anzukommen. Olga Grjasnowa, geboren 1984 in Baku (Aserbaidschan), ist Schriftstellerin. Sie wuchs im Kaukasus auf, siedelte 1996 nach Deutschland um und studierte Kunstgeschichte in Göttingen und Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. 2011 und 2019 erhielt sie das Grenzgänger-Stipendium der Robert-Bosch-Stiftung. Werke u.a.: "Der Russe ist einer, der Birken liebt" (2012), "Der verlorene Sohn" (2020). Hörspiele für Deutschlandfunk Kultur: "Die Midlife-Crisis ist nicht nur für Männer da" (2022).
Neue Musik
Musik unserer Zeit Klaus-von-Bismarck-Saal, Köln Aufzeichnung vom 29.09.2023 Peter Eötvös "Ligetidyll" (2022/23) György Kurtág "Hommage à Ligeti, op. 48" (2023) Ligetis Jahrhundert - Schweifen durch die Vergangenheit Peter Eötvös "Respond" für Viola und 32 Musiker (1997/2021) György Kurtág "Jelek (encore)" Karlheinz Stockhausen "Kontra-Punkte" (1951/52) für 10 Instrumente Timothy Ridout, Viola WDR Sinfonieorchester Leitung: Gergely Madaras